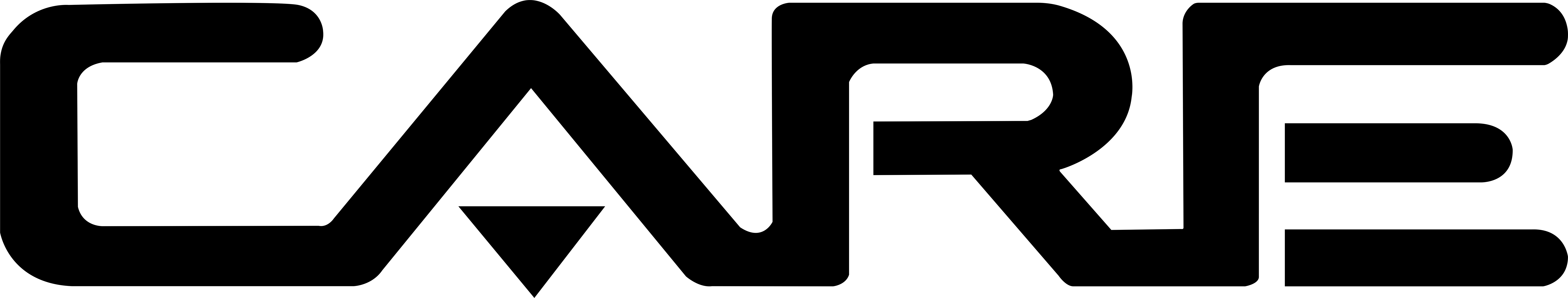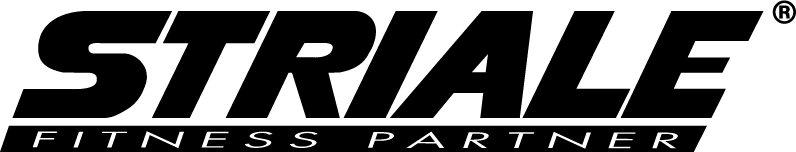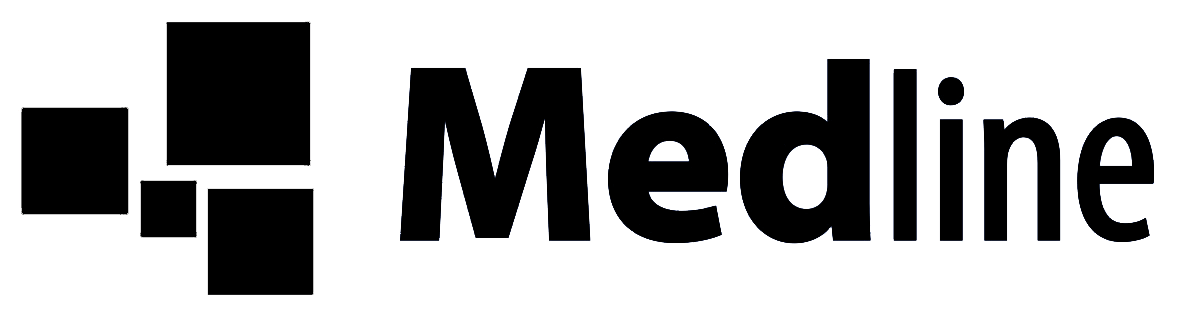Leistungskonzepte im Krafttraining: 1RM, Tempo und Zirkeltraining
Das 1RM (maximale Wiederholung) misst Ihre Maximalkraft und dient als Referenz zur Berechnung Ihrer Trainingslasten über Formeln wie Brzycki oder Epley.
Das Tempo kontrolliert die Ausführungsgeschwindigkeit jeder Bewegungsphase und moduliert die Zeit unter Spannung (40-70 Sekunden), um das Muskelwachstum zu maximieren.
Das Zirkeltraining reiht mehrere Übungen mit minimaler Pause aneinander und entwickelt gleichzeitig Muskelausdauer, kardiovaskuläres Conditioning und zeitliche Effizienz.
Inhaltsverzeichnis
-
Das 1RM: absolute Referenz der Maximalkraft
-
Sein 1RM ohne direkten Maximaltest berechnen
-
Das 1RM in der Programmierung nutzen
-
Tempo: Ausführungsgeschwindigkeit meistern
-
Die Bewegungsphasen zerlegen
-
Zeit unter Spannung und Muskelhypertrophie
-
Zirkeltraining: Effizienz und Vielseitigkeit
-
Ein effektives Zirkeltraining aufbauen
-
Entwicklung der körperlichen Kondition
-
Technologien und fortgeschrittene Leistungskonzepte
Krafttraining reduziert sich nicht mehr auf zufälliges Gewichtheben. Drei Konzepte verwandeln empirisches Training in quantifizierbare Wissenschaft: 1RM, Tempo und Zirkeltraining. Jedes misst, kontrolliert und entwickelt unterschiedliche, aber komplementäre physische Qualitäten. Ihre Beherrschung ändert alles: Schluss mit dem Herumtasten, Platz für rationale Progression.
Das 1RM etabliert den Maßstab Ihrer Maximalkraft. Das Kennen dieser einzigartigen Last hilft Ihnen, Ihre Arbeitsgewichte präzise zu bestimmen: 70 kg für 10 Wiederholungen (Hypertrophie), 85 kg für 5 Wiederholungen (Kraft), 60 kg für 15 Wiederholungen (Ausdauer). Kein Raten mehr - Sie programmieren mit Präzision und Sicherheit.
Das Tempo verfeinert die motorische Kontrolle, indem es die Geschwindigkeit jeder Bewegungsphase vorschreibt. Diese Variable moduliert die Zeit unter Spannung, einen bestimmenden Faktor der Hypertrophie. Die Abwärtsbewegung verlangsamen? Sie maximieren Muskelschäden. Die Aufwärtsbewegung beschleunigen? Sie entwickeln Explosivität. Alles hängt von Ihrem Ziel ab.
Zirkeltraining strukturiert die Übungsabfolge zur Maximierung der Trainingsdichte, des Kalorienverbrauchs und des kardiovaskulären Conditioning, ohne den muskulären Stimulus zu opfern. Dieser vielseitige Ansatz eignet sich für enge Zeitpläne und Fettabbau-Ziele.
Das 1RM: absolute Referenz der Maximalkraft
Das 1RM, Abkürzung für „One Repetition Maximum”, bezeichnet die maximale Last, die einmal mit korrekter Technik bei einer bestimmten Übung bewegt werden kann. Diese Messung quantifiziert die absolute Maximalkraft, die Summe der muskulären Kontraktionsfähigkeiten und der neuromuskulären Effizienz. Ein 1RM von 150 kg bei der Kniebeuge? Sie gehen einmal nach unten und kommen mit dieser Last wieder hoch, aber eine zweite Wiederholung ist unmöglich.
Jede Übung besitzt ihr eigenes 1RM: Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben, Schulterdrücken, gewichtete Klimmzüge. Diese Werte spiegeln die Kraft der beteiligten Muskelgruppen wider. Ein Powerlifter hat drei offizielle 1RM (Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben), die zur Bestimmung der Gesamtsumme im Wettkampf addiert werden.
Definition und Bedeutung des 1RM
Die maximale Wiederholung repräsentiert den Schnittpunkt zwischen verfügbarer Muskelkraft und externem Widerstand. Bei diesem Lastniveau rekrutiert das neuromuskuläre System simultan alle verfügbaren motorischen Einheiten, von langsam- bis schnellzuckenden Fasern. Das Versagen tritt ein, wenn die erzeugte Kraft trotz maximaler Anstrengung den Widerstand nicht mehr überwinden kann.
Das 1RM drückt reine konzentrische Kraft aus, die Fähigkeit, den Muskel unter maximaler Last zu verkürzen. Diese Kraft unterscheidet sich von der exzentrischen Kraft (Verlängerung unter Spannung), die in der Regel 20-40% über dem 1RM liegt. Sie können 100 kg konzentrisch drücken, aber die Abwärtsbewegung von 120-140 kg exzentrisch kontrollieren. Diese Asymmetrie findet Anwendung in fortgeschrittenen exzentrischen Trainingstechniken.
Warum die Maximalkraft messen
Das Kennen seines 1RM strukturiert die Programmierung, indem es eine objektive Referenz zur Berechnung der Trainingslasten liefert. Wissenschaftliche Protokolle schreiben die Intensität in Prozent des 1RM statt in absoluter Last vor und ermöglichen so eine präzise Individualisierung. Ein Hypertrophie-Programm, das „4 Sätze à 8 Wiederholungen bei 75% des 1RM” empfiehlt, passt sich automatisch dem Niveau jedes Trainierenden an: 75 kg für denjenigen mit 1RM von 100 kg, 112,5 kg für denjenigen mit 150 kg.
Das 1RM alle 2-3 Monate zu messen, objektiviert die Progression und validiert die Programm-Effektivität. Eine Steigerung von 10 kg beim Bankdrücken über 12 Wochen? Das Protokoll funktioniert. Stagnation oder Rückgang? Die Trainingsvariablen (Volumen, Intensität, Häufigkeit, Erholung) müssen angepasst werden.
Das 1RM dient auch als Leistungskriterium im Wettkampf: Powerlifting, Kraftsport und olympisches Gewichtheben klassifizieren Athleten nach ihren 1RM in den kodifizierten Bewegungen. Außerhalb des Wettkampfs liefert das 1RM einen universellen Maßstab: „Ich beuge das 2-Fache meines Körpergewichts” kommuniziert sofort das erreichte Kraftniveau.
Sein 1RM ohne direkten Maximaltest berechnen
Der direkte 1RM-Test ist präzise, birgt aber Verletzungsrisiken und erhebliche systemische Ermüdung. Die Hantel maximal zu beladen, beansprucht Gelenke, Sehnen und Nervensystem an der äußersten Grenze. Anfänger ohne technische Beherrschung oder Trainierende ohne verfügbaren Spotter sollten diese direkten Tests vermeiden.
Die mathematischen Formeln schätzen das 1RM aus submaximalen Lasten (75-95% des 1RM), die für mehrere Wiederholungen (2-10 Wdh.) bewegt werden. Diese Formeln nutzen die inverse Beziehung zwischen Last und möglicher Wiederholungszahl: Je höher die Last, desto weniger Wiederholungen schaffen Sie. Indem Sie messen, wie viele Wiederholungen Sie mit einer gegebenen Last ausführen, extrapolieren Sie mathematisch das theoretische 1RM.
Schätzungsformeln: Brzycki und Epley
Die Brzycki-Formel stellt die am weitesten verbreitete Referenz im Kraftraum dar. Sie lautet: 1RM = Gewicht × (36 / (37 - Anzahl der Wiederholungen)).
Ein Trainierender, der 80 kg für 6 Wiederholungen hebt, berechnet sein geschätztes 1RM: 80 × (36 / (37 - 6)) = 80 × (36 / 31) = 80 × 1,161 = 92,9 kg, gerundet auf 93 kg.
Die Epley-Formel, eine populäre Alternative, vereinfacht die Berechnung: 1RM = Gewicht × (1 + Anzahl der Wiederholungen / 30). Mit denselben Daten (80 kg × 6 Wdh.): 80 × (1 + 6/30) = 80 × 1,2 = 96 kg. Die Epley-Formel neigt zu leichter Überschätzung des 1RM im Vergleich zu Brzycki, wobei sich der Unterschied verstärkt, wenn die Wiederholungszahl 10 überschreitet.
Andere Formeln existieren (Lombardi, Mayhew, Wathan) und variieren leicht in ihren Vorhersagen. Die optimale Präzision wird mit Lasten erreicht, die 85-90% des 1RM repräsentieren, also 3-6 maximale Wiederholungen. Über 10 Wiederholungen hinaus (Last unter 75% des 1RM) beeinflusst die Muskelausdauer die Leistung stärker als reine Kraft, was die Schätzung verzerrt.
Sicheres submaximales Testprotokoll
Der submaximale Test beginnt mit progressivem Aufwärmen über 3-4 Sätze:
|
Satz |
Wiederholungen |
Last |
Ziel |
|
1 |
10 |
30-40% des geschätzten 1RM |
Muskelaktivierung |
|
2 |
6 |
50-60% des geschätzten 1RM |
Progressive Steigerung |
|
3 |
3-4 |
70-75% des geschätzten 1RM |
Annäherung an die Testintensität |
Die Pausenzeiten erstrecken sich auf 2-3 Minuten zwischen den Aufwärmsätzen, um die neuromuskuläre Frische zu bewahren.
Der Testsatz wird bei 85-90% des geschätzten 1RM für 3-5 maximale Wiederholungen durchgeführt. Wenn Sie genau die angestrebten Wiederholungen erreichen (Beispiel: 4 Wdh. geplant, 4 Wdh. geschafft), bestätigt sich die anfängliche Schätzung. Wenn Sie mehr schaffen (6-7 statt 4), überschreitet Ihr tatsächliches 1RM die Schätzung und erfordert eine Anpassung. Umgekehrt signalisiert eine geringere Anzahl (2 statt 4) eine Überschätzung.
Wenden Sie die gewählten Formeln (Brzycki oder Epley) an und mitteln Sie die Ergebnisse zur Verfeinerung der Schätzung. Ein Test alle 8-12 Wochen verfolgt die tatsächliche 1RM-Progression und passt die Trainingslasten an. Diese Häufigkeit balanciert den Aktualisierungsbedarf und die Notwendigkeit der Erholung nach einem anstrengenden Test.
Das 1RM in der Programmierung nutzen
Das 1RM dient als Berechnungsgrundlage zur Bestimmung der wöchentlichen Lasten entsprechend dem angestrebten Ziel. Die relativen Intensitätsbereiche (1RM-Prozentsätze) entsprechen spezifischen physiologischen Anpassungen. Diese Last-Ziel-Korrespondenz strukturiert jede rationale Programmierung.
Die Manipulation der 1RM-Prozentsätze über die Wochen hinweg erzeugt die Periodisierung, den geplanten Wechsel zwischen Volumen- und Intensitätsphasen. Wellenförmige Zyklen verändern die relative Intensität wöchentlich (Woche 1 bei 70%, Woche 2 bei 75%, Woche 3 bei 80%, Woche 4 Entlastung bei 60%), während lineare Zyklen über 4-12 Wochen progressiv steigern (Start bei 65%, Ende bei 90%).
Trainingsprozentsätze nach Zielen
Hier sind die Intensitätszonen nach Zielen:
|
Ziel |
% des 1RM |
Wiederholungen |
Sätze |
Pause |
|
Maximalkraft |
85-95% |
1-5 |
4-6 |
3-5 Min |
|
Hypertrophie |
65-80% |
6-12 |
3-5 |
60-120 Sek |
|
Muskelausdauer |
50-65% |
15-25+ |
4-6 |
30-60 Sek |
Maximalkraft: Bei 90% des 1RM führen Sie 3-4 maximale Wiederholungen mit strenger Technik aus. Diese hohen Intensitäten entwickeln die neuronale Rekrutierung, die Synchronisation der motorischen Einheiten und die Kontraktionseffizienz. Mehrere Sätze (4-6 Sätze) mit langen Pausen (3-5 Minuten) akkumulieren ein ausreichendes Volumen, ohne die Intensität zu gefährden.
Muskelhypertrophie: Zwischen 65 und 80% des 1RM für 6-12 Wiederholungen. Bei 75% des 1RM führen Sie 8-10 Wiederholungen bis zum Versagen aus. Diese Zone balanciert mechanischen Stress (erzeugte Spannung) und metabolischen Stress (Laktatakkumulation, Kongestion), das optimale Duo für Wachstum.
Muskelausdauer: Bei 60% des 1RM entwickeln lange Sätze die oxidative Kapazität, Mitochondriendichte und Ermüdungswiderstandsfähigkeit. Diese moderaten Intensitäten erlauben hohe Volumina (4-6 Sätze) und kurze Pausen (30-60 Sekunden), typischer Ansatz des Zirkeltrainings.
Wöchentliche Lasten anpassen
Die lineare Programmierung erhöht die relative Intensität über mehrere Wochen progressiv. Ein 8-Wochen-Zyklus beginnt bei 70% des 1RM (10 Wiederholungen pro Satz) und gipfelt bei 85% (5 Wiederholungen pro Satz), mit einer wöchentlichen Progression von 2-3%. Die absolute Last bleibt konstant oder steigt leicht an, während die Wiederholungen abnehmen, je mehr die Intensität steigt.
Die wellenförmige Periodisierung variiert die Intensität innerhalb der Woche: schwere Einheit bei 85% (5 Wdh.), mittlere Einheit bei 75% (8 Wdh.), leichte Einheit bei 65% (12 Wdh.). Diese konstante Variation verhindert Anpassung und Stagnation und moduliert gleichzeitig die neuromuskuläre Ermüdung. Fortgeschrittene Trainierende profitieren besonders von diesem Ansatz, der den Stimulus frisch hält.
Die Entlastungswochen, alle 4-6 Wochen programmiert, reduzieren Volumen und Intensität um 40-50%. Eine typische Woche bei 80% des 1RM (6 Wdh. × 4 Sätze) wird während der Entlastung zu 60% des 1RM (6 Wdh. × 2 Sätze). Diese periodische Regeneration erhält die langfristige Progression und verhindert Übertraining.
Tempo: Ausführungsgeschwindigkeit meistern
Das Tempo im Krafttraining schreibt die Ausführungsgeschwindigkeit jeder Bewegungsphase vor. Diese Variable beeinflusst dramatisch den muskulären Stimulus, die Zeit unter Spannung und die erzielten Anpassungen. Zwei Wiederholungen beim Bankdrücken mit 80 kg erzeugen radikal unterschiedliche Stimuli, je nachdem, ob das Tempo 1-0-1-0 (explosive Wiederholung von 2 Sekunden) oder 4-2-1-0 (kontrollierte Wiederholung von 7 Sekunden) ist.
Die Tempokontrolle verbessert die Geist-Muskel-Verbindung, das propriozeptive Bewusstsein und die technische Qualität. Anfänger profitieren von langsamen Tempi (3-0-2-0), die sie zwingen, eine korrekte Bewegungsbahn beizubehalten und Kompensationen durch Schwung oder Abprallen verhindern. Fortgeschrittene manipulieren das Tempo strategisch: Verlangsamen der exzentrischen Phase (4-0-1-0) zur Maximierung der Muskelschäden, Beschleunigen der konzentrischen Phase (2-0-X-0, X bedeutet explosiv) zur Kraftentwicklung.
Tempo-Notation in vier Phasen
Die Tempo-Notation wird in vier durch Bindestriche getrennten Ziffern geschrieben, wobei jede Ziffer die Dauer in Sekunden einer spezifischen Phase darstellt:
3-0-1-0 bedeutet:
-
Erste Ziffer (3): Exzentrische Phase (Abwärtsbewegung beim Bankdrücken, Aufwärtsbewegung beim Klimmzug), Phase, in der sich der Muskel unter Spannung verlängert
-
Zweite Ziffer (0): Pausendauer in gestreckter Position (Hantel am Brustbein beim Bankdrücken, untere Position bei der Kniebeuge)
-
Dritte Ziffer (1): Konzentrische Phase (Aufwärtsbewegung beim Bankdrücken, Abwärtsbewegung beim Klimmzug), Phase, in der sich der Muskel unter Krafterzeugung verkürzt
-
Vierte Ziffer (0): Pause in kontrahierter Position (gestreckte Arme beim Bankdrücken, obere Position bei der Kniebeuge)
Eine „0” bedeutet keine Pause, ein „X” zeigt eine so schnell wie mögliche explosive Ausführung an.
Tempi lesen und anwenden
Das Tempo 3-0-1-0 bei der Kniebeuge bedeutet: 3 Sekunden zum Absenken in die tiefe Position, keine Pause unten, 1 Sekunde zum Hochkommen, keine Pause oben vor dem erneuten Absenken. Diese Notation standardisiert die Verschreibung und stellt sicher, dass zwei Trainierende, die dasselbe Tempo anwenden, einen ähnlichen Stimulus erzeugen. Die Gesamtdauer einer Wiederholung addiert die vier Ziffern: 3+0+1+0 = 4 Sekunden pro Wiederholung.
Das Tempo 4-2-1-0 beim Bankdrücken schreibt vor: 4 Sekunden kontrollierte Abwärtsbewegung der Hantel zum Brustbein, 2 Sekunden Pause mit unbeweglicher Hantel am Brustbein, 1 Sekunde Aufwärtsbewegung mit gestreckten Armen, keine Pause mit gestreckten Armen. Dieses 7-Sekunden-Tempo pro Wiederholung erzeugt einen sehr anspruchsvollen Satz, bei dem 8 Wiederholungen 56 Sekunden dauern, hohe Zone der Zeit unter Spannung günstig für Hypertrophie.
Explosive Tempi verwenden „X” für die konzentrische Phase: 3-0-X-0 bedeutet langsame Abwärtsbewegung von 3 Sekunden, gefolgt von einer maximal explosiven Aufwärtsbewegung. Dieser Ansatz entwickelt Kraft, indem er das Nervensystem lehrt, schnellzuckende Fasern rasch zu rekrutieren. Powerlifter und Gewichtheber nutzen explosive Tempi ausgiebig, um Kraft in Wettkampfleistung zu übertragen.
Die Bewegungsphasen zerlegen
Jede Wiederholung zerlegt sich in drei mechanisch unterschiedliche Phasen, die jeweils den Muskel unterschiedlich beanspruchen und spezifische Anpassungen erzeugen. Die exzentrische Phase verlängert den Muskel unter Last, die konzentrische Phase verkürzt ihn unter Krafterzeugung, die isometrischen Phasen halten eine konstante Länge. Das Verstehen dieser Phasen ermöglicht eine feine Manipulation des Stimulus für Hypertrophie, Kraft oder Power.
Die drei Kontraktionsarten rekrutieren die Muskelfasern unterschiedlich und erzeugen ungleiche Kräfte. Die exzentrische Kontraktion produziert 120-140% der maximalen konzentrischen Kraft, daher die Fähigkeit, die Abwärtsbewegung von Lasten über dem 1RM zu kontrollieren. Die isometrische Kontraktion erzeugt 105-115% der konzentrischen Kraft. Diese Hierarchie (exzentrisch > isometrisch > konzentrisch) erklärt, warum fortgeschrittene Techniken verlangsamte exzentrische Phasen oder reine exzentrische Überladungen nutzen.
Exzentrische Phase: Kontrolle und Muskelschäden
Die exzentrische oder Negativ-Phase verlängert den Muskel gegen den Widerstand. Beim Bankdrücken entspricht sie dem Absenken der Hantel zum Brustbein, wobei sich die Brustmuskeln dehnen, während sie die Last abbremsen. Bei der Kniebeuge verlängert die Abwärtsbewegung in die tiefe Position exzentrisch die Quadrizeps und Gesäßmuskeln. Diese Phase erzeugt mehr Muskelschäden (Mikrorisse der Sarkomere) als die konzentrische Phase, den Hauptauslöser für Hypertrophie.
Das absichtliche Verlangsamen der exzentrischen Phase (3-5 Sekunden) verstärkt diese kontrollierten Schäden und intensiviert den Wachstumsstimulus. Das Tempo 4-0-1-0 widmet 80% der Gesamtdauer (4 Sekunden von 5) der exzentrischen Phase. Diese exzentrische Betonung verursacht intensiveren Muskelkater (DOMS) 24-72h nach der Einheit, ein Zeichen erhöhten muskulären Traumas, das adäquate Erholung erfordert.
Die fortgeschrittenen exzentrischen Techniken nutzen die Überlegenheit der exzentrischen Kraft. Die assistierten Negativwiederholungen belasten 110-130% des konzentrischen 1RM: Ein Partner hilft beim Hochdrücken, während der Trainierende allein die Abwärtsbewegung über 4-6 Sekunden kontrolliert. Die rein exzentrischen Wiederholungen (ohne konzentrische Phase) belasten den Muskel dramatisch und erfordern eine aufmerksame Aufsicht zur Verletzungsprävention.
Konzentrische und isometrische Phasen
Die konzentrische Phase verkürzt den Muskel, indem sie Kraft gegen den Widerstand erzeugt. Die Aufwärtsbewegung beim Bankdrücken kontrahiert die Brustmuskeln, vorderen Deltamuskeln und Trizeps, um die Hantel zurückzustoßen. Der Aufstieg aus der tiefen Kniebeugen-Position rekrutiert Quadrizeps, Gesäßmuskeln und hintere Oberschenkelmuskulatur in einer Dreifachstreckung (Knöchel, Knie, Hüften). Diese konzentrische Phase bestimmt die maximal bewegbare Last (1RM) und repräsentiert die Leistungsgrenze.
Das Beschleunigen der konzentrischen Phase entwickelt explosive Power und schnelle Rekrutierung motorischer Einheiten. Das Tempo X (explosiv) befiehlt dem Nervensystem, sofort das Maximum verfügbarer Fasern zu aktivieren. Diese Beschleunigungsabsicht bleibt entscheidend, wenn sich die Hantel mit schweren Lasten nicht schnell bewegt: Der Versuch, 90% des 1RM explosiv zu bewegen, rekrutiert mehr motorische Einheiten als langsames Drücken.
Die isometrischen Phasen, statische Pausen in gestreckter oder kontrahierter Position, eliminieren den Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus und den myotatischen Reflex. Eine 2-Sekunden-Pause mit der Hantel am Brustbein (zweite Ziffer des Tempos) erzwingt die Krafterzeugung aus einer statischen Position, intensivierte neuronale Rekrutierung. Isometrische Pausen verstärken Schwachstellen in der Bewegungsbahn: Pause am tiefsten Punkt der Kniebeuge für den unteren Sticking Point, Pause auf halber Höhe beim Bankdrücken für die schwierige Zone.
Zeit unter Spannung und Muskelhypertrophie
Die Zeit unter Spannung (TUT), die Dauer, während der der Muskel während eines Satzes kontrahiert bleibt, beeinflusst die Muskelhypertrophie direkt. Ein Satz, der den Muskel 40 bis 70 Sekunden unter Spannung hält, schafft ein optimales metabolisches Umfeld für Wachstum: Laktatakkumulation, lokale Hypoxie, Zellschwellung und Freisetzung anaboler Faktoren. Dieses Zeitfenster balanciert mechanisches Trauma (ausreichend, um Fasern zu beschädigen) und metabolischen Stress (Akkumulation wachstumsstimulierender Metaboliten).
Die TUT-Berechnung multipliziert die Wiederholungszahl mit der Dauer einer Wiederholung (Summe der vier Tempo-Ziffern). Ein Satz von 10 Wiederholungen im Tempo 3-0-2-0 (5 Sekunden pro Wiederholung) erzeugt 50 Sekunden TUT, zentrale Zone der Hypertrophie. Derselbe Satz im Tempo 2-0-1-0 (3 Sekunden pro Wiederholung) produziert nur 30 Sekunden TUT, unzureichend zur Maximierung des metabolischen Stimulus.
Optimale Zone für Wachstum
Wissenschaftliche Forschung situiert die optimale TUT für Hypertrophie zwischen 40 und 70 Sekunden pro Satz.
|
TUT |
Haupteffekt |
Anwendung |
|
Weniger als 30 Sek |
Neurologische Kraft |
Entwicklung reiner Kraft |
|
30-40 Sek |
Kompromiss Kraft-Volumen |
Zwischenzone |
|
40-70 Sek |
Maximale Hypertrophie |
Optimales Muskelwachstum |
|
Mehr als 70 Sek |
Muskelausdauer |
Ermüdungswiderstandsfähigkeit |
Eine TUT von 50 Sekunden stellt das zentrale Ziel dar: Satz von 8 Wiederholungen im Tempo 3-0-3-0 (6 Sekunden × 8 = 48 Sekunden) oder 12 Wiederholungen im Tempo 2-0-2-0 (4 Sekunden × 12 = 48 Sekunden). Diese beiden Konfigurationen erzeugen ähnliche TUT, beanspruchen aber die Energiesysteme leicht unterschiedlich: Die erste bevorzugt schwerere Lasten und mechanisches Trauma, die zweite höheres Volumen und metabolische Kongestion.
Die TUT durch das Tempo manipulieren
Die TUT ohne Änderung der Wiederholungszahl zu erhöhen, verlangsamt das Tempo. Ein Satz von 10 Wiederholungen geht von 30 Sekunden TUT (Tempo 2-0-1-0) auf 60 Sekunden (Tempo 3-0-3-0), indem die Dauer jeder Phase verdoppelt wird. Diese Manipulation intensiviert das Muskelbrennen und die Kongestion, ohne die Satzstruktur zu ändern oder eine Lastanpassung zu erfordern.
Umgekehrt bietet die Beibehaltung einer konstanten TUT bei gleichzeitiger Variation von Wiederholungen und Tempo taktische Flexibilität. Ziel von 60 Sekunden TUT: 15 Wiederholungen im Tempo 2-0-2-0 (4 Sekunden × 15 = 60s) oder 10 Wiederholungen im Tempo 3-0-3-0 (6 Sekunden × 10 = 60s). Die erste Version verwendet eine leichtere Last und entwickelt die metabolische Ausdauer, die zweite eine schwerere Last und erhöhtes mechanisches Trauma.
Langsame Tempi (4-0-2-0 oder 5-0-3-0) erzwingen eine Lastreduktion von 20-30% im Vergleich zum spontanen Tempo. Ein Trainierender, der normalerweise 80 kg für 10 Wiederholungen im Tempo 2-0-1-0 hebt, kann nur 60 kg laden, um 10 Wiederholungen im Tempo 4-0-2-0 beizubehalten. Diese Lastreduktion zeigt keine Schwäche an, sondern eine Verlängerung der TUT, die die lokalen Energiereserven schneller erschöpft.
Zirkeltraining: Effizienz und Vielseitigkeit
Das Zirkeltraining reiht mehrere Übungen (6-12) mit minimaler Pause zwischen ihnen aneinander, gefolgt von einer längeren Erholung vor der Wiederholung der kompletten Runde. Diese Organisation maximiert die Trainingsdichte (Arbeitsmenge pro Zeiteinheit) und hält die Herzfrequenz erhöht, wodurch ein hybrider muskulär-kardiovaskulärer Stimulus entsteht. Ein typischer Zirkel umfasst 8 Übungen, die jeweils 45 Sekunden lang ausgeführt werden mit 15 Sekunden Übergang, wiederholt über 3-4 Runden mit 2 Minuten Pause zwischen den Runden.
Die Zirkel zielen auf allgemeines Conditioning statt auf Maximalkraft oder reine Hypertrophie ab. Die verwendeten Lasten repräsentieren 50-70% des 1RM und ermöglichen die Beibehaltung der Technik trotz kumulativer Ermüdung. Diese moderate Intensität erlaubt ein hohes Volumen ohne übermäßiges Gelenkrisiko, ein idealer Ansatz für Anfänger, Fettabbau oder Entlastungsphasen.
Prinzip des Zirkeltrainings
Das Grundprinzip beruht auf dem Wechsel zwischen Muskelgruppen, um die Intensität ohne vollständige Pause aufrechtzuerhalten. Während ein Muskel arbeitet (Quadrizeps bei der Kniebeuge), erholen sich andere (Brustmuskeln, Rücken, Arme), was den sofortigen Übergang zur nächsten Übung (Liegestütze) erlaubt. Diese teilweise aktive Erholung ermöglicht eine höhere Trainingsdichte als traditionelle Sätze mit 2-3 Minuten vollständiger Pause.
Die Zirkel strukturieren sich nach Stationen: Jede Übung bildet eine Station, an der der Trainierende eine definierte Dauer oder Wiederholungen verbringt.
|
Format |
Beschreibung |
Vorteil |
|
Zeitbasiert |
40-60 Sek Arbeit pro Station, 10-20 Sek Übergang |
Geeignet für Gruppen oder Gruppenkurse |
|
Wiederholungen |
Feste Anzahl (12-15 Wdh.) an jeder Station, sofortiger Übergang |
An Einzelpersonen angepasst |
Vorteile des Zirkeltrainings
Zirkeltraining reduziert die Einheitendauer von 60-90 Minuten auf 30-45 Minuten bei gleichzeitiger Beibehaltung des Gesamtvolumens. Diese zeitliche Kompression zieht Trainierende mit wenig Zeit an, die maximale Effizienz suchen. Ein Zirkel von 8 Übungen × 12 Wiederholungen × 3 Runden akkumuliert 288 Gesamtwiederholungen in 25-30 Minuten, ein Volumen vergleichbar mit einer traditionellen Einheit von 60 Minuten.
Der Kalorienverbrauch steigt dramatisch im Vergleich zu klassischen Sätzen. Die kontinuierliche Abfolge hält die Herzfrequenz 20-40 Minuten lang bei 70-85% der HFmax und verbrennt je nach Intensität und Körpermasse 300-500 Kalorien. Diese kardiovaskuläre Komponente erklärt die Beliebtheit des Zirkeltrainings für Fettabbau-Ziele und die Verbesserung der Körperkomposition.
Das allgemeine Conditioning verbessert sich schnell. Zirkel entwickeln die Fähigkeit, die Leistung unter kumulativer Ermüdung aufrechtzuerhalten, eine Qualität, die auf Sport und alltägliche Aktivitäten übertragbar ist. Nach 8-12 Wochen Zirkeltraining toleriert der Trainierende höhere Trainingsvolumina und erholt sich schneller zwischen den Sätzen.
Ein effektives Zirkeltraining aufbauen
Der Aufbau eines Zirkels respektiert die Prinzipien des Muskelwechsels, der Intensitätssteigerung und des Gleichgewichts zwischen den Muskelgruppen.
|
Niveau |
Übungen |
Last |
Runden |
Pause zwischen Runden |
|
Anfänger |
6-8 Körpergewichtsübungen oder leichte Lasten |
Hanteln 5-10 kg, Kettlebell 8-12 kg |
2-3 |
2-3 Min |
|
Fortgeschrittene |
8-10 Übungen |
50-70% 1RM |
3-4 |
90 Sek |
Die Übungsauswahl zielt auf eine vollständige Körperbeanspruchung ab, wobei vorzeitige lokalisierte Ermüdung vermieden wird. Das Wechseln zwischen Ober- und Unterkörper, Druck- und Zugbewegungen, hält die Intensität über den gesamten Zirkel aufrecht. Drei aufeinanderfolgende Beinübungen aneinanderzureihen (Kniebeuge-Ausfallschritt-Leg Curl) erschöpft die Quadrizeps und erzwingt eine Intensitätsreduktion, was die Effektivität gefährdet.
Übungsauswahl und -reihenfolge
Ausbalancierte Zirkel wechseln Bewegungsmuster ab: horizontaler Druck (Liegestütze, Bankdrücken), horizontaler Zug (Rudern), vertikaler Druck (Schulterdrücken), vertikaler Zug (Klimmzug), Squat (Goblet Squat), Hinge (rumänisches Kreuzheben), Core (Plank), Cardio (Battle Rope, Burpees). Diese Sequenz beansprucht Brustmuskeln, Rücken, Schultern, Beine, Rumpf und kardiovaskuläres System ohne Redundanz.
Die Reihenfolge schreitet vom Allgemeinen zum Spezifischen, vom Globalen zum Lokalen fort. Beginnen Sie mit schweren mehrgelenkigen Übungen (Kniebeuge, Rudern), wenn die Energie am höchsten ist, beenden Sie mit Isolationen (Curl, Extension) oder statischem Core-Training, wenn die Ermüdung einsetzt. Diese Hierarchie erhält die technische Qualität bei komplexen Bewegungen und reduziert das Verletzungsrisiko.
Die logischen Übergänge minimieren die Totzeit und Gerätwechsel. Die Gruppierung von Übungen, die dasselbe Equipment benötigen (drei aufeinanderfolgende Kettlebell-Bewegungen) oder dieselbe Position (drei Bodenübungen), beschleunigt den Zirkelfluss. Zirkel zu Hause nutzen überwiegend das Körpergewicht (Liegestütze, Kniebeugen, Ausfallschritte, Planks, Mountain Climbers) mit minimalistischem Zubehör (ein Paar Hanteln, Widerstandsband).
Dauer, Intensität und Erholung
Das klassische Format schreibt 40-60 Sekunden Arbeit pro Station mit 10-20 Sekunden Übergang vor. Ein Zirkel mit 8 Stationen dauert 6,5 bis 10 Minuten pro Runde (8×50s Arbeit + 8×15s Übergang = 6,5 Min). Drei Runden ergeben insgesamt 20-30 Minuten effektive Arbeit, zu denen 2 Minuten Pause zwischen den Runden hinzukommen, also 26-36 Minuten gesamt.
Tabata-Varianten wenden ein 20-Sekunden-Arbeit / 10-Sekunden-Pause-Format über 8 Runden an (4 Minuten gesamt pro Übung), maximale Intensität. AMRAP-Zirkel (As Many Rounds As Possible) legen eine Gesamtdauer fest (20 Minuten), während der der Trainierende unbegrenzt Runden aneinanderreiht und die Anzahl der abgeschlossenen Runden als Leistungsmetrik zählt. Dieses Format gamifiziert das Training und fördert das Übertreffen.
Die Intensität wird durch Last, Ausführungsgeschwindigkeit und Erholungsdichte kalibriert. Hochintensive metabolische Zirkel (Lasten 60-70% 1RM, Übergänge 10 Sekunden, Pause zwischen Runden 60-90 Sekunden) erschöpfen in 20 Minuten und dienen als Schockphasen oder Finisher. Moderate Zirkel (Lasten 50% 1RM, Übergänge 20 Sekunden, Pause 2-3 Minuten) dauern 40 Minuten und bauen Grundausdauer auf.
Entwicklung der körperlichen Kondition
Das körperliche Conditioning, die Fähigkeit, die Leistung unter Ermüdung aufrechtzuerhalten und sich schnell zu erholen, vervollständigt Maximalkraft und Hypertrophie im Leistungstriptychon. Ein starker aber dekonditionierter Trainierender hat Mühe, Sätze in kurzen Abständen aneinanderzureihen oder die Intensität während langer Einheiten aufrechtzuerhalten. Zirkeltraining entwickelt diese Arbeitskapazität (Work Capacity), die das tolerierbare Trainingsvolumen untermauert.
Die Energiesysteme, die die Anstrengung versorgen (aerob, anaerob-laktazid, anaerob-alaktazid), reagieren spezifisch auf Belastungsdauern und -intensitäten. Zirkeltraining beansprucht vorrangig die aeroben (kontinuierliche moderate Belastung 20+ Minuten) und anaerob-laktaziden (intensive Belastungen 30s-2min mit Laktatakkumulation) Wege. Diese gemischte Stimulation verbessert sowohl die kardiovaskuläre Grundausdauer als auch die Toleranz gegenüber Ermüdungsprodukten.
Lokale Muskelausdauer
Muskelausdauer, die Fähigkeit einer Muskelgruppe, wiederholte Kontraktionen durchzuführen oder eine verlängerte Kontraktion aufrechtzuerhalten, unterscheidet sich von der allgemeinen kardiovaskulären Ausdauer. Ein Trainierender, der 10 km laufen kann (hohe Cardio-Ausdauer), kann daran scheitern, 50 Wiederholungen Kniebeuge bei 50% seines 1RM durchzuführen (niedrige lokale Muskelausdauer der Beine).
Die Zirkel entwickeln diese lokale Ausdauer durch zahlreiche Wiederholungen (12-20 pro Übung) und kurze Pausen zwischen den Sätzen. Die Muskeln lernen, unter relativer Hypoxie zu funktionieren (unzureichende Blutzufuhr zur Deckung des Bedarfs), wodurch die Laktatpuffer-Kapazität und die Effizienz oxidativer Enzyme verbessert werden. Nach 6-8 Wochen Zirkeltraining tritt das Muskelbrennen später auf und die Erholung zwischen den Sätzen beschleunigt sich.
Lange Sätze am Ende einer Hypertrophie-Einheit (3×20 Wdh. bei 50-60% 1RM, 45 Sekunden Pause) bauen spezifische Muskelausdauer auf. Dieser hybride Ansatz kumuliert die Vorteile schwerer Sätze (Hypertrophie, Kraft) und lokales Conditioning (Ermüdungstoleranz). Die Beine profitieren besonders von dieser Ausdauerarbeit, die Vaskularisation und Erholungsfähigkeit verbessert.
Kardiovaskuläre und metabolische Kapazität
Die kardiovaskuläre Kapazität, die Effizienz des kardiorespiratorischen Systems beim Sauerstofftransport zu aktiven Muskeln, wird durch die VO2max (maximale Sauerstoffaufnahme) gemessen. Eine hohe VO2max (50+ ml/kg/min bei Männern, 45+ bei Frauen) korreliert mit allgemeiner Ausdauer und schneller Erholung zwischen den Sätzen. Traditionelles Krafttraining verbessert die VO2max nur wenig (Zuwächse 5-10%), während Zirkeltraining und HIIT substantielle Fortschritte generieren (15-25%).
Zirkel, die die Herzfrequenz 20-40 Minuten lang bei 70-85% HFmax halten, stimulieren kardiovaskuläre Anpassungen: Herzhypertrophie, Erhöhung des Schlagvolumens, muskuläre Kapillarverdichtung. Diese zentralen (Herz, Lunge, Gefäße) und peripheren (Kapillaren, Mitochondrien) Anpassungen reduzieren die Ruheherzfrequenz und beschleunigen die Rückkehr zur Baseline nach der Belastung.
Das metabolische Conditioning (Metcon) zielt speziell auf die Toleranz gegenüber Metaboliten und die Effizienz der Energieresynthese-Systeme ab. HIIT-Zirkel, die intensive Phasen (85-95% HFmax, 30-60 Sekunden) mit aktiver Erholung (60-70% HFmax, 60-90 Sekunden) abwechseln, verbessern die Fähigkeit, hohe Intensität trotz Laktatakkumulation aufrechtzuerhalten. Das Tabata-Protokoll (8×20s max/10s Pause) oder EMOM (Every Minute On The Minute: Übung zu Beginn jeder Minute, Pause den Rest) stellen fortgeschrittene Metcon-Formate dar.
Technologien und fortgeschrittene Leistungskonzepte
Moderne Technologien verfeinern die Messung und Verschreibung des Trainings über die klassischen Metriken hinaus (1RM, Volumen, Tempo). Geschwindigkeitssensoren, Beschleunigungsmesser und Kraftmessplatten quantifizieren Explosivität, Echtzeit-Ermüdung und neuromuskuläre Effizienz. Diese Werkzeuge, anfangs der Sportelite vorbehalten, werden über Smartphone-Apps und erschwingliches Equipment für ernsthafte Trainierende zugänglich.
Die fortgeschrittenen Konzepte (VBT, RFD, VO2max) ergänzen das Arsenal der Leistungsmetriken. Ihr Verständnis unterscheidet eine ausgefeilte Programmierung von einem rudimentären Ansatz, der ausschließlich auf der Belastungswahrnehmung basiert.
Velocity Based Training (VBT)
VBT misst die Hantelgeschwindigkeit während jeder Wiederholung über an der Hantel befestigte Sensoren oder Video-Apps. Diese Geschwindigkeit korreliert präzise mit dem 1RM-Prozentsatz: Leichte Lasten (50-60% 1RM) bewegen sich schnell (1,0-1,2 m/s), schwere Lasten (85-90% 1RM) langsam (0,3-0,5 m/s). Das Messen der Geschwindigkeit bei jedem Satz informiert sofort über akkumulierte Ermüdung und Trainingsqualität.
Der intra-set Geschwindigkeitsverlust quantifiziert die neuromuskuläre Ermüdung. Wenn die erste Wiederholung 0,8 m/s erreicht und die zehnte auf 0,6 m/s fällt, signalisiert der 25%ige Verlust erhebliche Ermüdung. VBT-Protokolle empfehlen den Satzabbruch bei 15-20% Geschwindigkeitsverlust (Hypertrophie) oder 5-10% (Kraft). Diese objektive Autoregulation vermeidet Übertraining und garantiert gleichzeitig einen ausreichenden Stimulus.
Das VBT passt die Lasten entsprechend der Tagesform an. Ein Trainierender, der normalerweise 100 kg mit 0,5 m/s bewegt, aber an diesem Tag nur 0,45 m/s erreicht, reduziert die Last auf 95 kg, um die Zielgeschwindigkeit wiederzufinden. Diese tägliche Anpassung optimiert die langfristige Progression, indem Variationen bei Erholung, Stress und Schlaf berücksichtigt werden.
Rate of Force Development (RFD) und VO2max
Der RFD misst die Geschwindigkeit, mit der der Muskel Kraft erzeugt, ein entscheidendes Kriterium in explosiven Sportarten. Berechnet als die Steigung der Kraft-Zeit-Kurve während der ersten 200 Millisekunden der Kontraktion, unterscheidet der RFD explosive Athleten (hoher RFD) von starken aber langsamen (niedriger RFD). Ein Gewichtheber, der 2000 Newton in 150 ms produziert, besitzt einen höheren RFD als ein Powerlifter, der dieselbe Kraft in 400 ms erreicht.
Das RFD-Training nutzt leichte bis moderate Lasten (30-70% 1RM), die mit maximaler explosiver Absicht bewegt werden. Olympische Bewegungen (Clean, Snatch), Plyometrie (Sprünge) und ballistische Übungen (Kettlebell Swings) entwickeln das RFD effektiv. Das explosive Tempo (X) in der konzentrischen Phase lehrt eine schnelle neuronale Rekrutierung, die für Explosivität unverzichtbar ist.
Die VO2max, ein Ausdauerkonzept, beeinflusst die Erholung im Krafttraining. Eine hohe VO2max beschleunigt die Elimination von Metaboliten zwischen den Sätzen und die Wiederherstellung der Phosphagene. Trainierende, die Kraft und hohe VO2max kombinieren (50+ ml/kg/min), tolerieren höhere Volumina und progredieren schneller als diejenigen, die Cardio-Conditioning vernachlässigen (35-40 ml/kg/min). Zwei wöchentliche Einheiten Zirkeltraining oder HIIT (20-30 Minuten) reichen aus, um eine adäquate VO2max aufrechtzuerhalten, ohne Kraftzuwächse zu gefährden.
FAQ
Wie berechnet man sein 1RM ohne Verletzungsrisiko?
Verwenden Sie die Brzycki-Formel nach einem submaximalen Test bei 85-90% des geschätzten 1RM für 3-5 Wiederholungen. Beispiel: 80 kg × 5 Wdh. ergeben 1RM = 80 × (36/(37-5)) = 90 kg. Wärmen Sie progressiv über 3-4 Sätze auf und lassen Sie 8-12 Wochen zwischen Tests, um die Progression zu verfolgen.
Welches Tempo für maximale Hypertrophie wählen?
Das Tempo 3-0-2-0 oder 4-0-2-0 erzeugt 40-70 Sekunden Zeit unter Spannung bei 8-12 Wiederholungen, die optimale Zone für Muskelwachstum. Das Verlangsamen der exzentrischen Phase (3-5 Sekunden) erzeugt mehr Muskelschäden als die schnelle konzentrische Phase.
Baut Zirkeltraining wirklich Muskeln auf?
Zirkeltraining baut Muskelmasse bei Anfängern und Fortgeschrittenen auf, die Lasten von 50-70% des 1RM mit ausreichendem Volumen verwenden (3-4 Runden, 8-12 Übungen). Die Zuwächse bleiben unter reinen Hypertrophie-Protokollen (75-80% 1RM, lange Pausen), aber zeitliche Effizienz und Conditioning kompensieren.
Welche ist die beste Formel zur Schätzung des 1RM?
Die Brzycki- und Epley-Formeln bieten vergleichbare Präzision bei Tests mit 3-6 Wiederholungen. Brzycki (1RM = Gewicht × 36/(37-Wdh.)) neigt zu leichter Unterschätzung, Epley (1RM = Gewicht × (1+Wdh./30)) zu Überschätzung. Das Mitteln beider Ergebnisse verfeinert die Schätzung.
Wie viel Zeit unter Spannung pro Satz für Hypertrophie?
Zielen Sie auf 40 bis 70 Sekunden TUT pro Satz, die Zone, die mechanischen und metabolischen Stress balanciert. Ein Satz von 10 Wiederholungen im Tempo 3-0-2-0 dauert 50 Sekunden, ideal für Wachstum. Über 70 Sekunden hinaus übernimmt die Muskelausdauer.
Ist Zirkeltraining für absolute Anfänger geeignet?
Anfänger-Zirkel mit Körpergewicht oder leichten Lasten (6-8 Übungen, 2-3 Runden, 2-3 Minuten Pause) entwickeln Technik, Conditioning und Selbstvertrauen ohne Risiko. Beginnen Sie mit einem zeitbasierten Format (30-40 Sekunden pro Station), das zugänglicher ist als feste Wiederholungen.
Wie schnell beim 1RM progredieren?
Folgen Sie einem linearen Zyklus von 8-12 Wochen, beginnend bei 70% des aktuellen 1RM (10 Wdh.) und progredierend zu 90% (3 Wdh.), wöchentliche Steigerung von 2-3%. Testen Sie das neue 1RM nach einer Entlastungswoche, erwarten Sie je nach Übung und Niveau Zuwächse von 5-15 kg.
Was ist Velocity Based Training?
VBT misst die Hantelgeschwindigkeit, um Lasten täglich entsprechend der Form anzupassen und Ermüdung zu quantifizieren. Ein Geschwindigkeitsverlust von 20% während des Satzes signalisiert den Abbruch für Hypertrophie, 10% für Kraft. Diese Autoregulation optimiert die langfristige Progression.
Macht langsames Tempo stärker?
Langsame Tempi (4-0-2-0) verbessern die motorische Kontrolle und die Geist-Muskel-Verbindung, entwickeln aber nicht die Maximalkraft so stark wie explosive Tempi (2-0-X-0). Für reine Kraft beschleunigen Sie die konzentrische Phase absichtlich, die Hantel bewegt sich langsam bei schweren Lasten.
Wie lange dauert ein effektives Zirkeltraining?
Ein effektiver Zirkel dauert 25-40 Minuten: 6-10 Übungen × 40-60 Sekunden, 3-4 Runden, 90-120 Sekunden Pause zwischen den Runden. Kurze HIIT-Zirkel (15-20 Minuten) bieten maximale Effizienz für Trainierende mit wenig Zeit.
Glossar
1RM (One Repetition Maximum): Maximale Last, die einmal mit korrekter Technik bei einer bestimmten Übung bewegt werden kann, Referenz für Maximalkraft.
Maximalkraft: Fähigkeit, maximale Muskelspannung gegen einen externen Widerstand zu erzeugen, entwickelt mit Lasten von 85-95% 1RM für 1-5 Wiederholungen.
Tempo: Vorschrift der Ausführungsgeschwindigkeit der vier Bewegungsphasen (exzentrisch-Pause-konzentrisch-Pause), notiert in Sekunden.
Zeit unter Spannung (TUT): Dauer, während der der Muskel während eines Satzes kontrahiert bleibt, berechnet durch Multiplikation der Wiederholungen mit der Dauer einer Wiederholung.
Zirkeltraining: Abfolge mehrerer Übungen mit minimaler Pause, entwickelt Muskelausdauer und kardiovaskuläres Conditioning.
Exzentrische Phase: Phase der Muskelverlängerung unter Last (Absenken beim Bankdrücken), erzeugt mehr Muskelschäden als die konzentrische Phase.
Konzentrische Phase: Phase der Muskelverkürzung mit Krafterzeugung (Aufwärtsbewegung beim Bankdrücken), bestimmt die maximal bewegbare Last.
Isometrische Phase: Statisches Halten ohne Veränderung der Muskellänge, Pause in gestreckter oder kontrahierter Position.
Brzycki-Formel: 1RM = Gewicht × (36 / (37 - Anzahl der Wiederholungen)), die verbreitetste Formel zur Schätzung des 1RM.
Metabolisches Conditioning (Metcon): Training zur Verbesserung der Fähigkeit, hohe Intensität trotz Metabolitenakkumulation aufrechtzuerhalten.
VBT (Velocity Based Training): Methode, die die Hantelgeschwindigkeit nutzt, um Lasten anzupassen und Ermüdung in Echtzeit zu quantifizieren.
RFD (Rate of Force Development): Geschwindigkeit der Kraftentwicklung, gemessen während der ersten 200 ms der Kontraktion, Kriterium für Explosivität.
VO2max: Maximale Sauerstoffaufnahme gemessen in ml/kg/min, Indikator für aerobe Kapazität und Erholung zwischen den Sätzen.
1RM-Prozentsatz: Relative Intensität ausgedrückt als Bruchteil des 1RM (70%, 85%, 90%), bestimmt die angestrebten physiologischen Anpassungen.